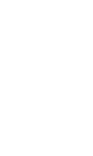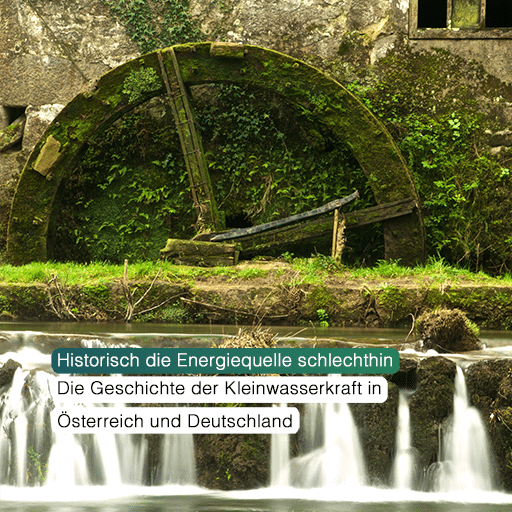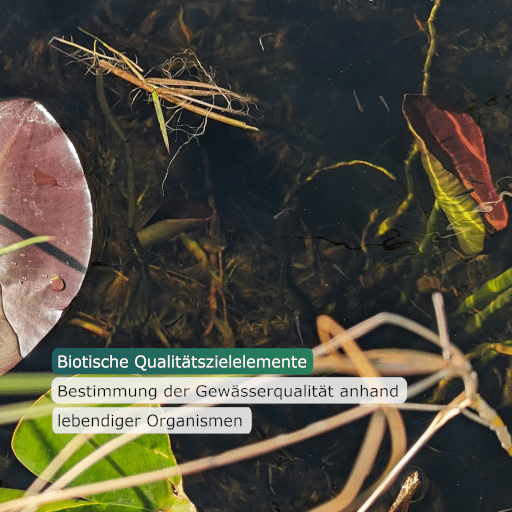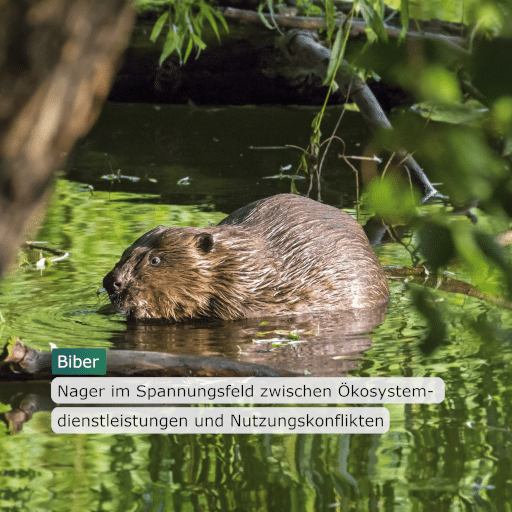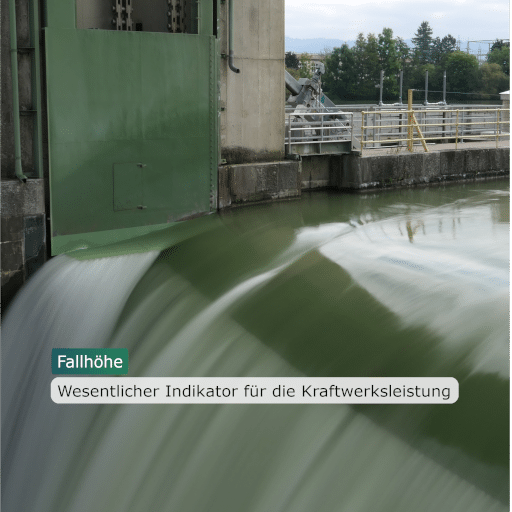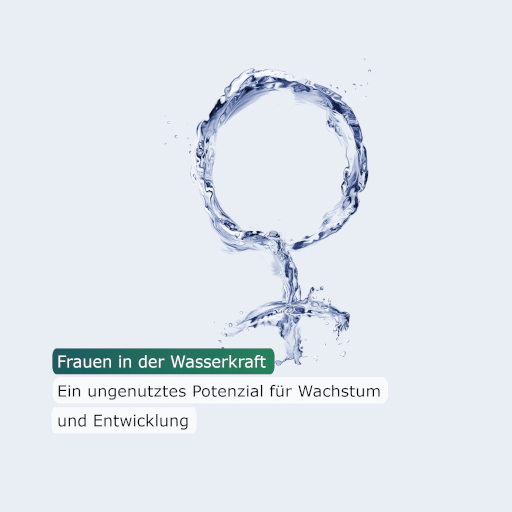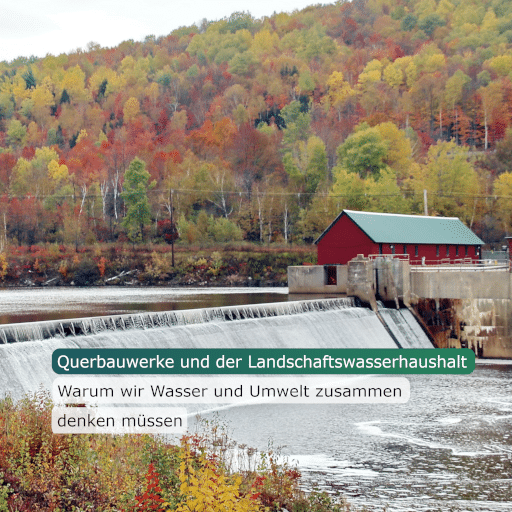Dass es einen geschlossenen Wasserkreislauf gibt ist schon lange bekannt, erste Aufzeichnungen stammen etwa von Anaxagoras und Diogenes von Apollonia aus der Zeit 499 – 427 v. Chr.
Die lange Reise eines Wassertropfens
Die Sonneneinstrahlung über dem Meer lässt täglich große Wassermassen verdunsten. Diese regnen dann entweder wieder über dem Meer ab oder können durch den Wind in Richtung Festland verblasen werden. Transportiert wird es in Gasform (Wasserdampf) und kann sich über längere Zeit in der Atmosphäre anreichern. Übersteigt die Konzentration von Wassermolekülen eine bestimmte Grenze, können sich in der Luft Kondensationskerne (Partikel in der Luft mit der Fähigkeit zur Wasseranlagerung) bilden und Wassertropfen oder Eiskristalle entstehen. Wassermoleküle können je nach Wetter über sehr weite Strecken transportiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass ein Molekül ungefähr 9 Tage in der Atmosphäre bleibt, bevor es abregnet.
Kommt es zum Abregnen, trifft das Wasser als erstes auf die Vegetationsdecke (Baumkronen, Gebüsche) und kann entweder sofort verdunsten oder gelangt bis zum Boden. Das Niederschlagswasser dringt in den Boden ein. Dieser Vorgang wird auch als Infiltration bezeichnet. Ist der Boden nicht durchlässig genug, rinnt es an der Oberfläche dem Gefälle entlang in den nächsten Bach oder Fluss (Vorfluter). Es entsteht ein sogenannter Oberflächenabfluss. Dieser ist besonders groß, je länger und stärker es regnet und wenn der Boden eine niedrige Infiltrationskapazität hat. Dadurch steigt die Überschwemmungsgefahr stark an. Auch die Schneeschmelze und Starkregen sind Beispiele dafür, dass das Entstehen von großen Oberflächenabflüssen durchaus zu einer Gefahr werden kann.
Wird das Niederschlagswasser vom Boden aufgenommen, können zunächst die Bodenwasservorräte aufgefüllt werden. Das überschüssige Wasser wird anschließend in tiefere Bodenschichten weitergeleitet. Pflanzenwurzeln können ebenfalls einen Teil des Wassers aufnehmen und über die Blattatmung (Transpiration) wieder an die Atmosphäre abgeben. Als Transpiration bezeichnet man den Prozess, bei dem Wasserdampf bei Pflanzen über den Blattspalt (Stomata) wieder an die Luft abgegeben werden kann.
Die Verdunstungsverluste von Schnee und Eis sind nur sehr gering, da die Schneeschmelze hauptsächlich von steigenden Lufttemperaturen und nicht von der Sonneneinstrahlung beeinflusst wird. Das Wasser sammelt sich nun im Grundwasser oder es kann aufgrund von undurchlässigen Bodenschichten nicht weiter versickern. Von dort aus fließt es entlang des Gefälles, bis es wieder in Flüssen, Bächen oder Seen austritt. Diese transportieren es dann wieder zurück ins Meer, wo der Zyklus von vorne beginnt.
Der Wasserkreislauf und das Klima
Die Auswirkungen der Klimakrise greifen nachweislich in den Wasserzyklus ein und verändern diesen irreversibel. Ein wesentlicher Faktor, der die Menge an Wasser in der Atmosphäre bestimmt, ist die Lufttemperatur. Je wärmer es ist, desto mehr Wasser gelangt über den Verdunstungsprozess in die Atmosphäre. Diese enormen Mengen müssen anschließend irgendwo wieder abregnen. Es kommt zu sehr starken Gewittern und Starkregenereignissen, wie man es teilweise bereits die letzten Jahre beobachten konnte. Auch die Unwetterereignisse und Überflutungen im August diesen Jahres sind auf dieses Phänomen zurückzuführen. Nicht in allen Gebieten wird die Verdunstungsrate gleich beschleunigt. Laut Prognosen des Weltklimarates (IPCC) sollen in Zukunft Küstenregionen deutlich nasser werden und von stärkeren Unwettern betroffen sein. Das Festland hingegen muss sich tendenziell auf Dürreperioden vorbereiten.
Je ausgetrockneter ein Boden ist, desto weniger ist er in der Lage, Wasser durch Versickerung aufzunehmen. Auch das ist ein Problem: Das Niederschlagswasser sammelt sich an der Oberfläche und kann nicht weiter eindringen. Die Hochwassergefahr steigt dadurch zusätzlich. Weiters sorgen hohe Temperaturen und eine höhere Kohlenstoff-Konzentration dafür, dass Pflanzen besser mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt werden. Sie sind somit in der Lage, durch Transpiration noch schneller größere Mengen an Wasser wieder an die Atmosphäre abzugeben.
Vegetation, Temperatur und Wetter beeinflussen den Wasserkreislauf. Durch den Klimawandel wird auch die Luftzirkulation stark beeinflusst, welche in direktem Zusammenhang mit dem Wasserkreislauf steht und umgekehrt. Luftzirkulation entsteht, wenn verdunstetes Wasser aufsteigt, abkühlt und anschließend herabregnet. Dieser Prozess kann Luftmassen in Bewegung setzen. Verdunstet in Zukunft mehr Wasser aufgrund der steigenden Temperaturen, sind mehr Wassermassen in der Atmosphäre, welche schwer prognostizierbare Bewegungen auslösen könnten. So prognostizierten mehrere Studien (unter anderem auch der IPCC-Bericht) den Kollaps des Golfstroms bis Ende des Jahrhunderts.
Das Fazit aus der Wissenschaft ist somit: Extreme Wetterereignisse werden intensiver und von längerer Dauer sein. Die durch Gewitter verursachten Schäden beliefen sich in Österreich in diesem Jahr bereits auf rund 4 Millionen Euro. Das absolute Rekordjahr 2021 verzeichnete fast 200 Millionen Euro an Kosten durch verursachte Schäden. Extremwetterereignisse sind somit nicht nur gefährlich, sondern auch sehr teuer – Tendenz steigend.
Auch die Kleinwasserkraftbranche wird in Zukunft mit Starkregenereignissen und Überschwemmungen wie im August 2023 vermehrt zu kämpfen haben. Im Hinblick darauf, dass (Klein-)wasserkraftwerke auch eine wichtige Schlüsselrolle im Hochwasserschutz haben, sollte der Ausbau weiter forciert werden. So kann dem Klimawandel durch den Umstieg auf Erneuerbare Energie entgegengewirkt werden und gleichzeitig Anpassungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die Wasserkraft nutzt diesen Kreislauf des Wassers, um regenerative Energie zu produzieren. Die Wasserkraft entnimmt dem Fluss das Wasser für kurze Zeit und fügt es dann unverändert und vollständig wieder zurück. Sie wandelt dabei die kinetische Energie des fließenden Wassers mit Hilfe von Turbinen und Generatoren in elektrische Energie um.
Eine unerschöpfliche Energiequelle im Einklang mit der Natur!