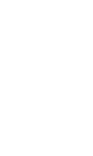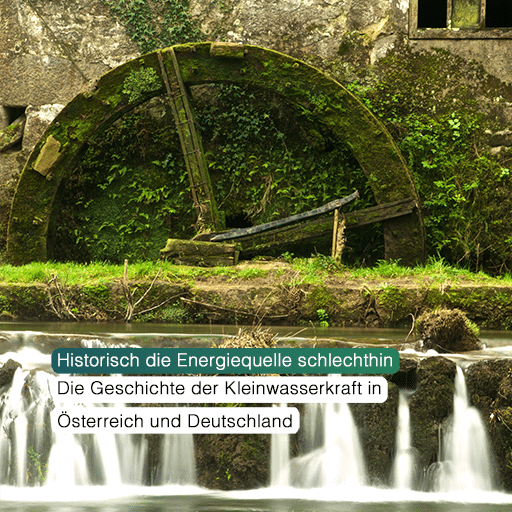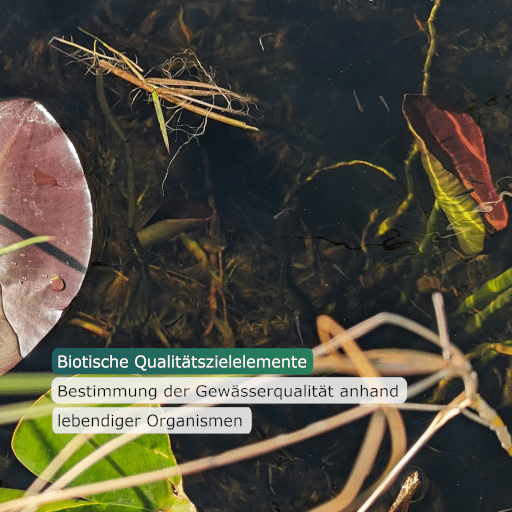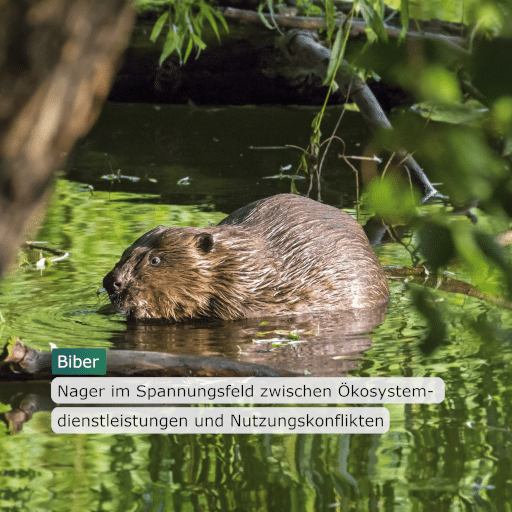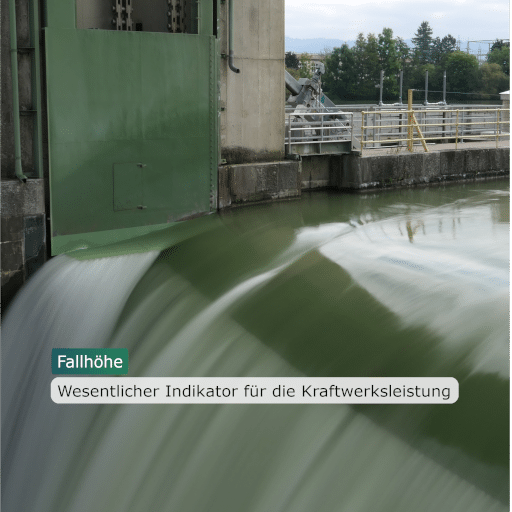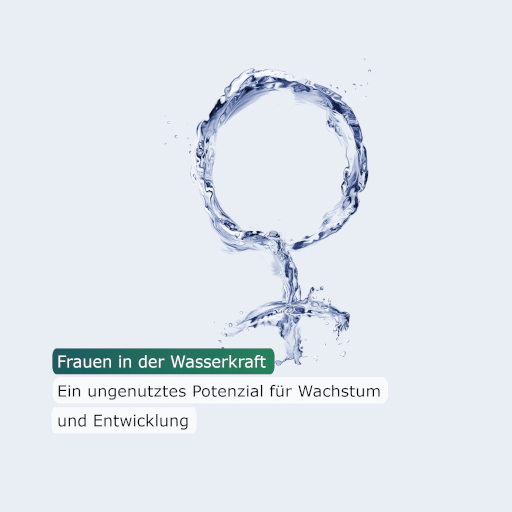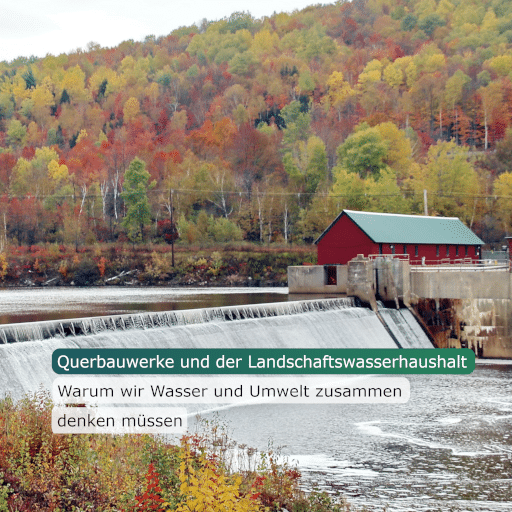Bei der Genehmigung von Wasserkraftanlagen in Deutschland sind das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in dem auch die Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verankert sind, und das Wassergesetz (WG) des jeweiligen Bundeslandes maßgeblich.
Das Vorhaben muss mit dem Flussgebietsmangementplan der Wasserbehörde vereinbar sein.
Für Baden-Württemberg nennt die „Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums, des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum und des Wirtschaftsministeriums zur gesamtökologischen Beurteilung der Wasserkraftnutzung“ die Kriterien für die Zulassung von Anlagen zur Nutzung der Wasserkraft bis 1000 kW:
- Grundsätze zur Ermessensbindung bei der Wasserkraftnutzung und weitere Vorgaben (§ 24 WG),
- Sicherstellung der für die ökologische Funktionsfähigkeit erforderlichen Wassermenge (Mindestwasserführung § 33 WHG, § 23 Abs. 1 WG),
- Berücksichtigung der Durchgängigkeit nach § 34 WHG,
- Gewährleistung des Schutzes der Fischpopulation nach § 35 WHG,
- Regelungen zur Gewässerökologie (§§ 1 und 6 Abs. l WHG, 12 Abs.1 und 2 WG),
- der allgemeine Vorsorgegrundsatz (§ 5 Abs. 1 WHG),
- eine naturnahe Gewässerentwicklung (§ 6 Abs. 2 WHG, § 12 Abs.2 WG),
- Vorgaben zur Benutzung und Wiedereinleitung nach § 14 Abs.2WG,
- das Verschlechterungsverbot nach § 27 Abs. 1 Nr. l und Abs. 2 WHG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1a, i. WRRL (Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der Wasserrahmenrichtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt.),
- das Zielerreichungs- oder Verbesserungsgebot nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 WHG in Verbindung mit Art 4 Abs. 1a, ii WRRL.
Bevor die Genehmigung für den Bau oder Weiterbetrieb einer Anlage erteilt wird, werden hydromorphologische, ökologische und energiewirtschaftliche Auswirkungen geprüft, sowie die Auswirkungen auf die Wasserbeschaffenheit, auf die Gewässerfunktionen, den Klimaschutz, der Beitrag zu lokalen Zielen der Energiewende und Vieles mehr.
Der Erfüllung dieser Tatbestände geht meist ein Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren voraus.
Es liegt am Antragsteller in seinem Erläuterungsbericht umfassende hydrologische Daten, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne und ausgearbeitete Bauzeichnungen einzureichen. Nicht selten kommt es zu Umplanungen.

Wer ein Wasserkraftwerk betreiben möchte braucht also einen langen Atem.
Dies gilt auch für die ökologische Aufrüstung von Anlagen, in denen Fischwanderhilfen gebaut werden. Genehmigungsverfahren dauern in Deutschland in der Regel etwa 10 Jahre.
Und auch nach der Genehmigung bleiben die Pflichten des Betreibers bestehen, wie etwa die gesetzlich festgelegte Unterhaltung der Gewässer, weitere Umweltauflagen und Vorgaben im Betriebsablauf.
Verfahren liegen im Ermessen der Behörden, bzw. der jeweiligen Sachbearbeiter und können somit von Behörde zu Behörde unterschiedlich ablaufen.
Das positiv beschiedene Genehmigungsverfahren kann zu zwei verschiedenen Ergebnissen führen: die wasserrechtliche Erlaubnis, die jedoch entschädigungslos entzogen werden kann oder die wasserrechtliche Bewilligung, die einem Eigentumsrecht auf Zeit ähnelt.
In Deutschland gibt es zudem sogenannte Altrechte, die die Nutzung einer festgesetzten Wassermenge bescheinigen. Wird dieses Recht über einen längeren Zeitraum nicht ausgeübt, kann es verfallen.