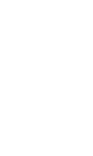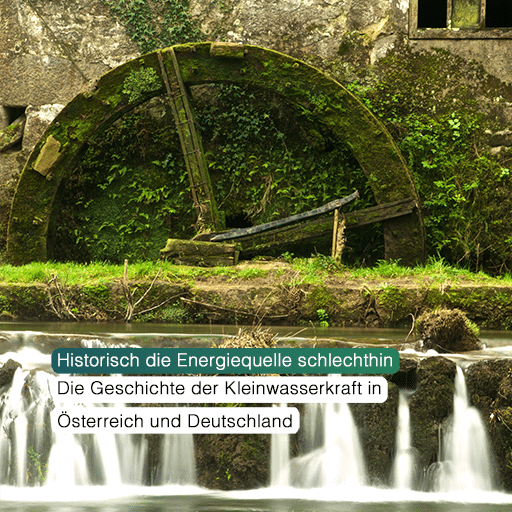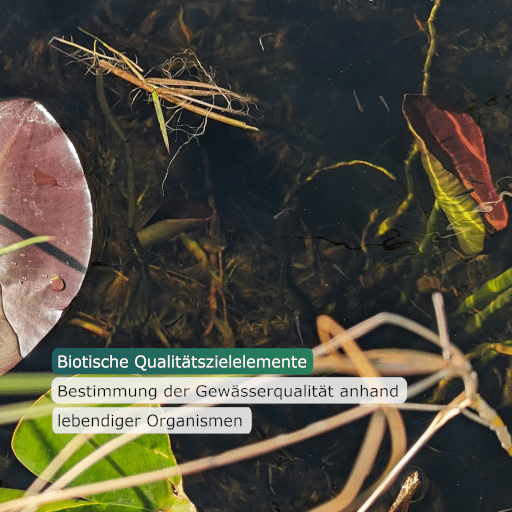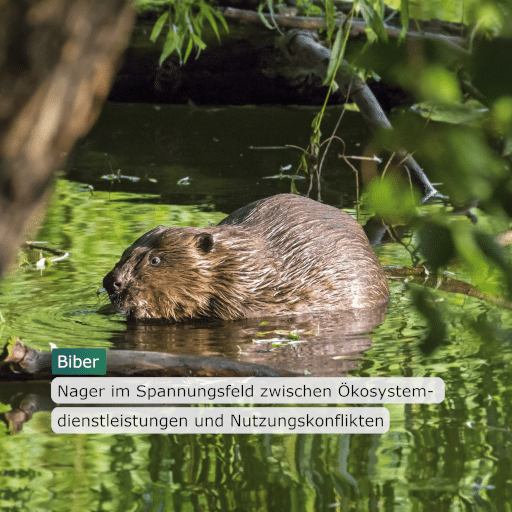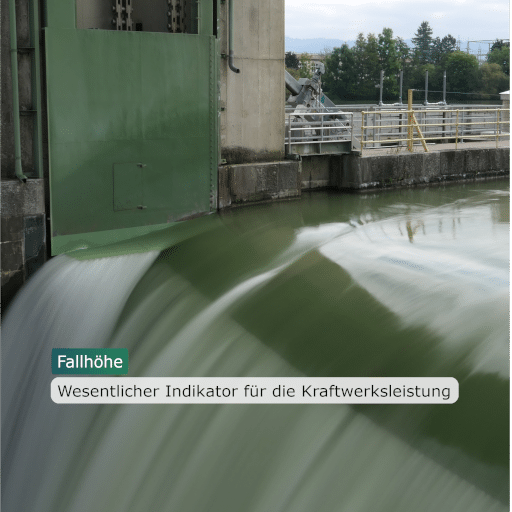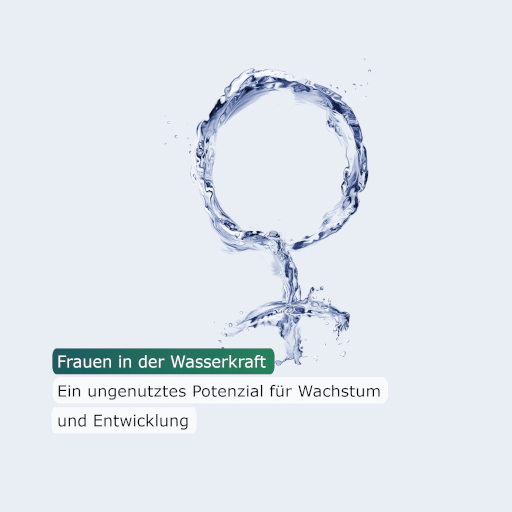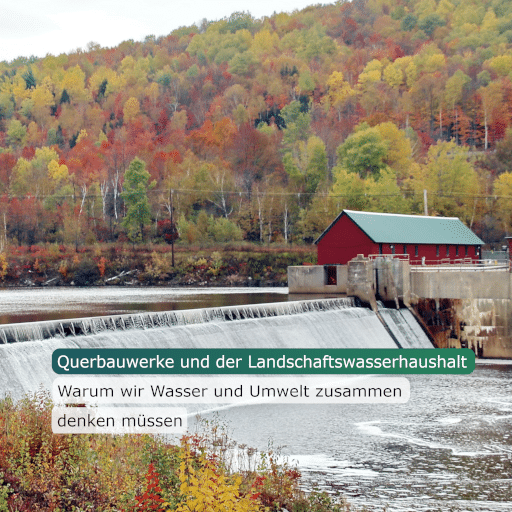Das Intergovernmental Panel on Climate Change (kurz IPCC) ist ein Gremium der Vereinten Nationen, das sich mit der wissenschaftlichen Auswertung und Einordnung von Klimaveränderungen beschäftigt.
Seit 1988 veröffentlicht die Organisation regelmäßig Berichte über die Grundlagen des Klimawandels, seiner Auswirkungen und über die zukünftigen Risiken, sowie mögliche Anpassungsoptionen zur Minderung dieser. Gegründet wurde das IPCC von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), mit dem Ziel, die Regierungen bestmöglich zu informieren, um eine gute Basis für deren Klimapolitik zu schaffen.
Die Organisation umfasst 195 Mitgliedsstaaten. Tausende Expert*innen stellen dabei ihre Zeit und ihr Know-How als IPCC-Autor*innen zur Verfügung, um die große Menge wissenschaftlicher Arbeiten zu bewerten und schlussendlich zu dem zusammenzufügen, was später als umfassender Bericht der aktuellen Klimasituation auf unserer Welt dienen soll. Dabei ist eine offene und transparente Prüfung durch Experten und Regierungen auf der ganzen Welt ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses, um eine unabhängige und vollständig nachvollziehbare Auswertung zu gewährleisten. Unter anderem kann dadurch auch aufgezeigt werden, in welchen Bereichen der Klimaveränderung noch Forschungsbedarf besteht. Eigene Forschungsarbeiten führt das IPCC allerdings nicht durch.
Wie arbeitet das IPCC?
Die Organisation ist in drei Arbeitsgruppen und eine Task Force aufgeteilt. Die erste Arbeitsgruppe befasst sich mit der wissenschaftlich fundierten Basis der Klimaerwärmung. Die zweite Arbeitsgruppe befasst sich hauptsächlich mit den Auswirkungen des Klimawandels, der Anpassung und den Risiken, wohingegen sich die dritte Gruppe mit den Möglichkeiten zur Verminderung des Klimawandels beschäftigt.
Die Hauptaufgabe der ist die Entwicklung und Verfeinerung der Methodik für die Berechnung und Berichterstattung nationaler Treibhausgasemissionen und deren Abbau. Für zusätzliche Bereiche und Themen steht es dem Gremium jedoch jederzeit frei, weitere Arbeitsgruppen für einen festgelegten Zeitraum ins Leben zu rufen, um ein bestimmtes Thema zu behandeln oder einer bestimmten Frage nachzugehen.
Wie entsteht ein Bericht des IPCC?
Die Bewertungsberichte bestehen aus den Beiträgen, die die Arbeitsgruppen ausarbeiten und einem Synthesebericht, der diese Beiträge zusammenfassend mit den Sonderberichten für den betreffenden Bewertungszyklus (dieser kann bis zu 3 Jahre dauern) vereint. Darüber hinaus erstellt das IPCC auch Sonderberichte zu bestimmten Themen, die von Mitgliedsregierungen vereinbart wurden.
Jeder IPCC-Bericht beginnt Scoping-Meeting, bei dem die Mitglieder ihre Gedanken und Vorschläge zur Vertiefung von Forschungsgebieten teilen können. Anschließend bereiten Expert*innen, die von Mitgliedsregierungen, Beobachterorganisationen und dem Präsidium nominiert wurden, einen Entwurf des Berichts für das Gremium vor. Auf dieser Basis entscheidet das Gremium dann, ob die Erstellung des Berichts fortgesetzt werden soll und einigt sich auf Umfang und Gliederung und erstellt einen Arbeitsplan inklusive Budget.
Nachdem die Arbeitsgruppen und die Taskforce Expertenlisten erstellt haben, um die IPCC-Autor*innen zu nominieren, sind nicht als Autor*innen ausgewählte Wissenschaftler dazu eingeladen, als Gutachter*innen für den Endbericht zur Verfügung zu stehen. Wichtig ist dabei ein ausgewogenes Verhältnis von erfahrenen und unerfahrenen Expert*innen des IPCC.
Am Ende eines Bewertungszyklus reflektiert das IPCC den Prozess der Berichterstellung und zieht Schlüsse, um zukünftige Arbeitsprogramme und Prozesse bestmöglich zu optimieren.